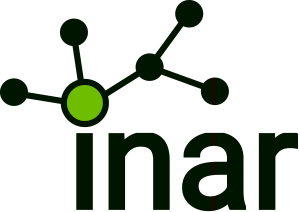Patienten mit Hyperhidrosis leiden unter starkem Schwitzen, vor allem an Händen, Füßen und im Gesicht. Wenn konventionelle Therapien nicht greifen, kann eine Operation eine gute Alternative sein. Hier bietet die Klinik für Thoraxchirurgie des Katholischen Klinikums Mainz Hilfe.
Mainz, 19. April 2013. Ständig feuchte Hände, Schweißflecken auf der Kleidung und permanentes Unwohlsein, negativ aufzufallen: Patienten, die an Hyperhidrosis – dem krankhaften Schwitzen – leiden, sind im Alltag oft stark eingeschränkt. Hyperhidrosis ist eine Hauterkrankung, bei der die Betroffenen stark an bestimmten Körperstellen schwitzen, etwa an den Händen oder unter den Achseln. Laut einer Studie, die im Journal of the American Academy of Dermatology veröffentlicht wurde, leiden rund drei Prozent der Bevölkerung unter diesem Problem.
„In der Behandlung sollten immer zuerst konservative Therapien zum Einsatz kommen“, berichtet Universitäts-Dozent Dr. Peter Hollaus, Chefarzt der Klinik für Thoraxchirurgie am Katholischen Klinikum Mainz. Oft kann durch Medikamente ein guter Erfolg erzielt werden. Darüber hinaus können je nach Ausprägung der Erkrankung und individueller Patientensituation auch Therapien mit Antitranspirantien oder Botulinumtoxin den gewünschten Erfolg bringen. Bleiben alle konservativen Therapien wirkungslos, kann eine Operation langfristig helfen.
Operation kann helfen
„Das übermäßige Schwitzen ist durch eine Überaktivität des Sympatikus-Nervs bedingt“, sagt Hollaus. Dieser verläuft an der Rückwand der Brusthöhle, links und rechts neben der Wirbelsäule. Im Rahmen einer sogenannten „thorakoskopischen Sympathektomie“ wird dieser Nerv mit kleinen Metallklipsen blockiert. Da er nur durch die Brusthöhle erreichbar ist wird die Operation klassischerweise von Thoraxchirurgen durchgeführt. Die Experten am Katholischen Klinikum Mainz bieten diese Operation an.
Dabei operieren sie minimalinvasiv über kleine Schnitte im Brustkorb: Unter Vollnarkose wird eine Spiegelung der Brusthöhle mit einer bleistiftdicken Kamera vorgenommen und der Nerv abgeklemmt. Bei unauffälligem Befund kann der Patient bereits am ersten Tag nach der Operation wieder entlassen werden.
Erfolg direkt spürbar – dennoch sollte OP die letzte Instanz bleiben
Die Operation selbst ist für einen erfahrenen Chirurgen ein Routineeingriff. Dank der modernen Schlüssellochtechnologie gibt es nur kleine Wundschnitte, die schnell verheilen. „Der Erfolg ist für den Patienten bald spürbar“, sagt Hollaus. „Nach der Operation haben die Patienten trockene, warme Hände.“
Eines darf jedoch nicht vergessen werden: „Die Unterbrechung des Grenzstranges kann auch Nebenwirkungen haben“, erklärt der Experte. Dazu zählen vor allem zu trockene Hände und das sogenannte ‚kompensatorische Schwitzen‘, was bedeutet, dass an anderen Körperstellen verstärkt geschwitzt wird. „Die meisten Patienten kommen damit gut zurecht, andere leiden darunter genauso wie unter dem starken Schwitzen der Hände.“ Daher ist es wichtig, dass vor der Entscheidung für eine Operation sämtliche nicht-operativen Therapien ausgenutzt werden.
2.802 Zeichen
Weiter Informationen sowie ein Erfahrungsbericht auch unter www.kkm-mainz.de/fachkliniken/Klinik-fuer-Thoraxchirurgie/patienten-info/schwitzhaende/
Den Text zum Download finden Sie unter folgendem Link auf unserer Internetseite:
www.kkm-mainz.de/Katholisches-Klinikum-Mainz/presse/pressemitteilungen
Über das Katholische Klinikum Mainz
Das Katholische Klinikum Mainz (kkm) mit seinen Standorten St. Hildegardis-Krankenhaus und St. Vincenz und Elisabeth Hospital ist ein Krankenhaus der Schwerpunktversorgung. Mit seinen zertifizierten Fachzentren (Brust-, Darm-, Schilddrüsen- und Lungenzentrum) sowie weiteren 15 Fachabteilungen, 717 Betten und über 1.500 Beschäftigten nimmt es einen überregionalen Versorgungsauftrag an zwei Standorten wahr. Jährlich werden im kkm etwa 44.000 Patienten ambulant und stationär behandelt. Das kkm hat einen im Landeskrankenhausplan verankerten Versorgungsauftrag und ist akademisches Lehrkrankenhaus der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Darüber hinaus betreibt es eine staatlich anerkannte Gesundheits- und Krankenpflegeschule mit derzeit 120 Ausbildungsplätzen für Gesundheits- und Krankenpflege.
Das Katholische Klinikum Mainz ist eine kirchliche Einrichtung des Caritasverbandes für die Diözese Mainz und der Marienhaus GmbH in Trägerschaft des Caritas-Werkes St. Martin gemeinnützige Träger- und Betriebsführungsgesellschaft mbH. Die Patientenversorgung erfolgt unter dem Leitsatz „menschlich und kompetent – für die Stadt und die Region“. Seit 2004 ist im kkm ein Qualitätsmanagementsystem etabliert, das Krankenhaus ist nach DIN ISO 9001:2008 zertifiziert, die Zentrale Sterilgutversorgungsabteilung (ZSVA) nach EN ISO 13485:2003.
Mehr Informationen: www.kkm-mainz.de
Sie möchten nichts verpassen? Abonnieren Sie schnell, unkompliziert und kostenlos unseren RSS Presse Feed. So erhalten Sie alle aktuellen Pressemitteilungen ganz automatisch.
Besuchen Sie uns auch auf facebook
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
Christina Becker
Unternehmenskommunikation
Katholisches Klinikum Mainz (kkm)
An der Goldgrube 11, 55131 Mainz
Telefon: 06131 / 575 832032
Telefax: 06131 / 575 2152
E-Mail: unternehmenskommunikation@kkmainz.de
www.kkm-mainz.de