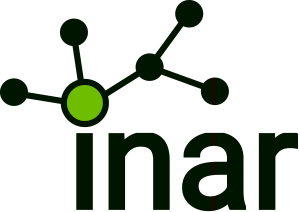EFNS/ENS Joint Congress of European Neurology: 31. Mai – 3. Juni 2014, Istanbul
Schlaganfall hat mit jährlich rund 600.000 Neuerkrankungen in Europa epidemische Ausmaße erlangt. Auf dem Joint Congress of European Neurology in Istanbul diskutierten internationale Experten/-innen aktuelle Erkenntnisse der Schlaganfallforschung: Frauen haben nach Schlaganfällen bei gleicher Behandlung ein schlechteres funktionelles Ergebnis. Die unterschätzten lakunären Schlaganfälle führen besonders oft zu geistigem Abbau und Demenz. Entzündungsprozesse könnten in der Entstehung von Schlaganfällen eine bisher unterschätzte Rolle spielen.
Istanbul, am 1. Juni 2014 – „In Europa werden jährlich zwischen 250 und 280 Schlaganfälle pro 100.000 Einwohner/-innen verzeichnet, in Summe sind das um die 600.000 Neuerkrankungen. Trotz großer Fortschritte in der Behandlung stellt uns diese epidemisch auftretende Krankheit immer noch vor große Herausforderungen, nicht nur in der Akutbehandlung, sondern auch in der Prävention und Rehabilitation“, sagte Prof. Franz Fazekas (Universitätsklinik für Neurologie, Graz) beim Joint Congress of European Neurology in Istanbul.
Frauen haben schwerere Schlaganfälle
Eine österreichische Studie, die auf dem Kongress vorgestellt wurde, zeigt auf, dass Frauen im Falle eines akuten Hirninfarkts oder einer transitorischen ischämischen Attacke nicht anderes versorgt werden als Männer, obwohl sie unterschiedliche Voraussetzungen mitbrachten. Laut Studiendaten waren Frauen zum Zeitpunkt des Schlaganfalls im Durchschnitt mehr als sieben Jahre älter als Männer, wiesen in einem höheren Ausmaß bereits bestehende Behinderungen auf und hatten schwerere Schlaganfälle. Trotz identer Akutversorgung und einer vergleichbaren Neurorehabilitationsrate fiel bei den Frauen das funktionelle Behandlungsergebnis schlechter aus, ihre Sterblichkeit war allerdings geringer. „Auch wenn noch weitere Studien zusätzlich die sozioökonomische Situation der Patienten/-innen nach dem Schlaganfall beleuchten sollten, liefern diese Ergebnisse deutliche Hinweise, dass genderspezifische Behandlungskonzepte die Therapieerfolge verbessern könnten“, betonte Prof. Fazekas. Die Studie basiert auf den Daten von mehr als 47.000 Personen aus dem österreichischen Schlaganfall-Register, die zwischen 2005 und 2012 in einer der 35 österreichischen Stroke Units behandelt worden waren. Knapp die Hälfte davon (47 Prozent) waren Frauen.
Akuten ischämischen Schlaganfall als „thrombo-entzündliche Erkrankung“ neu definieren
80 bis 90 Prozent der Schlaganfälle und der damit verbundenen plötzlichen neurologischen Ausfallerscheinungen gehen auf das Konto von Minderversorgung des Gehirns aufgrund von Durchblutungsstörungen, meist bedingt durch Thrombembolien. „Die intravenöse, medikamentöse Auflösung des Gerinnsels (Thrombolyse) innerhalb von 4,5 Stunden nach dem Schlaganfall ist das einzige überprüft wirksame Verfahren. Zusätzliche mechanische Eingriffe sind angezeigt, wenn Thromben über acht Millimeter groß sind und große Hirnversorgungsgefäße verschließen “, so Prof. Guido Stoll (Universitätsklinikum Würzburg). Trotz einer frühen Reperfusion der von einem Gerinnsel verschlossen intrakraniellen Arterien können Patienten/-innen einen fortschreitenden Schlaganfall aufweisen, ein als „Reperfusionsschaden“ bezeichneter Prozess. Neue Einsichten in die Rolle entzündlicher Prozesse bei der Entstehung des Schlaganfalls könnten den Weg für innovative therapeutische Ansätze bei diesem Problem liefern, berichtete Prof. Stoll in Instanbul. „Es gibt viele Hinweise, den akuten ischämischen Schlaganfall als thrombo-entzündliche Erkrankung neu zu definieren“, so Prof. Stoll. Im Tierversuch habe sich gezeigt, dass sowohl die Inhibition des von-Willebrand-Faktors, des Rezeptor-Glykoproteins GPIb oder des Kollagenrezeptors GPVI auf Blutplättchen, aber auch die Blockade von T-Zellen die Infarktentwicklung verhindern kann. „Multifunktionale Moleküle wie GPIb könnten neue therapeutische Targets liefern, die auf die Verbindung zwischen Entzündung und Thrombusbildung abzielen“, so Prof. Stoll.
Lakunäre Schlaganfälle forcieren geistigen Abbau
Geistiger Abbau und Demenz sind häufige Folgen von Schlaganfällen. „Mit den steigenden Überlebenschancen nach einem Schlaganfall gewinnt die Frage der Überlebensqualität immer mehr an Bedeutung. Es gilt, jene Ursachen und Mechanismen verstehen, einschätzen und verhindern zu lernen, die die geistige Gesundheit angreifen“, betonte Prof. Fazekas. Bislang war noch unklar, ob es Risikounterschiede je nach Art des ischämischen Schlaganfalls gibt. „Wie eine schottische Literaturstudie nahelegt, sind lakunäre Schlaganfälle, bei denen nur kleine Gefäße im Gehirn verstopft sind, bislang unterschätzt worden. Sie haben aber eine verheerende Wirkung: Die Prävalenz für Demenz nach einem solchen Schlaganfall liegt bei 20 Prozent, die Inzidenz für die Entwicklung einer leichten kognitiven Beeinträchtigung betrug 37 Prozent“, so Prof. Fazekas. Andere Arbeiten gehen davon aus, dass jede/-r zehnte Patient/-in innerhalb eines Jahres nach dem Schlaganfall eine Demenz entwickelt, es sei denn, die Schlaganfälle treten wiederholt auf. „Lakunäre Schlaganfälle scheinen besonders dann mit geistigem Abbau einherzugehen, wenn sie im Zusammenhang mit Mikroangiopathie auftreten, einer Erkrankung der kleinen Blutgefäße“, so Prof. Fazekas. „In weiteren Studien wird zu klären sein, ob der geistige Abbau in der Langzeitprognose bei lakunären Schlaganfällen anders verläuft als bei nicht-lakunären, nicht zuletzt deshalb, weil ihnen eine andere Pathologie zugrunde liegt. Möglichen geistigen Abbau vorhersagen zu können, wäre nicht zuletzt wichtig für Patienten/-innen und Angehörigen, die entsprechende Vorkehrungen für die Pflege treffen müssen. Die Neurologie wird weiter nach Möglichkeiten suchen müssen, um lakunäre Schlaganfälle zu verhindern oder den geistigen Abbau infolge der Erkrankung hintanzuhalten“, resümierte Prof. Fazekas.
Quellen:
Kongress-Abstracts: Gattringer et al: Gender aspects of acute stroke care: results from the Austrian Stroke Unit Registry; Stoll: Are platelet-immune cell interactions involved in reperfusion injury?
Sonstige: Pendlebury et al, Prevalence, incidence, and factors associated with pre-stroke and post-stroke dementia: a systematic review and meta-analysis, Lancet Neurol 2009; 8: 1006-18; Makin et al, Cognitive impairment after lacunar stroke: systematic review and meta-analysis of incidence, prevalence and comparison with other stroke subtypes, J Neurol Neurosurg Psychiatry 2013; 84, 893-900: Kleinschnitz et al.. Regulatory T cells are strong promoters of acute ischemic stroke in mice by inducing dysfunction of the cerebral microvasculature. Blood 2013; 121:679-691; Kraft et al. FTY720 ameliorates acute ischemic stroke in mice by reducing thrombo-inflammation but not by direct neuroprotection. Stroke 2013;44: 3202-10
Pressestelle Joint Congress of European Neurology
B&K – Bettschart&Kofler Kommunikationsberatung
Dr. Birgit Kofler
Mobil: +43-676-63 68 930
E-Mail: kofler@bkkommunikation.com
Skype: bkk_Birgit.Kofler