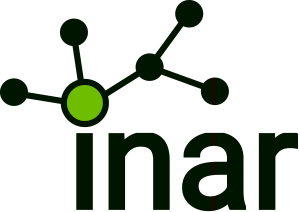EFNS/ENS Joint Congress of European Neurology: 31. Mai – 3. Juni 2014, Istanbul
Multiple Sklerose: Trend zur personalisierten Therapie – Biomarker für bessere Diagnose, Prognose und Therapiekontrolle
Eine frühzeitige und präzise Diagnose der Multiplen Sklerose und die frühe Behandlung mit modernen Medikamenten kann einen erheblichen Einfluss auf das Fortschreiten der Erkrankung haben, berichteten Experten beim Joint Congress of European Neurology in Istanbul. Wichtige Trends der modernen MS-Forschung sind individualisierte Therapieansätze, um Medikamente möglichst zielgerichtet einzusetzen und die oft schweren Nebenwirkungen effektiver zu vermeiden, und Biomarker, die eine immer wichtigere Rolle in der Diagnose und Therapiekontrolle der Krankheit spielen.
Istanbul, 2. Juni 2014 – „Multiple Sklerose (MS) ist derzeit nicht heilbar. Die in der jüngsten Zeit erzielten Fortschritte im Bereich der frühzeitigen und präzisen Diagnose und der möglichst frühen Behandlung mit wirksamen Substanzen sind jedoch entscheidend für die Lebensqualität Betroffener“ berichtete auf dem Joint Congress of European Neurology in Istanbul der MS-Experte Prof. Aksel Siva (Universität Istanbul). „Zu den wichtigsten Trends gehören die konstante Erweiterung der therapeutischen Möglichkeiten, die Minimierung der mitunter riskanten Nebenwirkungen von hochwirksamen Medikamenten, oder der Einsatz von Biomarkern für Diagnose, Prognose und Überwachung des Therapieverlaufs.“
Mehr als 600.000 Europäer/-innen und 2,8 Millionen Menschen weltweit leiden an der entzündlichen, degenerativen, fortschreitenden Autoimmunerkrankung MS – mit einer steigenden Prävalenz, die nicht zuletzt auf verbesserte Diagnosemöglichkeiten zurückzuführen ist. Im jungen Erwachsenenalter ist MS die häufigste neurologische Erkrankung die zu fortschreitender Behinderung führt.
Zentrale Herausforderungen in der MS-Forschung seien neben der Entwicklung neuer Medikamente die Verbesserung des Risikomanagements in Bezug auf verfügbare Substanzen, und eine verbesserte Früherkennung der Erkrankung, so Prof. Siva. „Trotz aller Fortschritte fehlen uns immer noch wichtige Antworten in der MS-Therapie.“ Doch diesen sind zahlreiche Forschergruppen weltweit auf der Spur. Das spiegelte sich auf dem Joint Congress of European Neurology wider, wo 10 wissenschaftliche Sitzungen und mehr als 200 neue Forschungsarbeiten allein dem Thema MS gewidmet waren. Ein viel diskutiertes Thema war die zunehmende Bedeutung von Biomarkern.
Biomarker gewinnen an Bedeutung für Diagnose und Prognose
„Mit der zunehmenden Identifizierung und Verwendung von Biomarkern wird ein neues und sehr vielversprechendes Kapitel im Management der MS eröffnet,“ so Prof. Siva. „Immer mehr Biomarker unterstützen uns heute dabei, rasch und nicht-invasiv Diagnosen zu bestätigen oder auszuschließen, den weiteren Krankheitsverlauf abzuschätzen oder den möglichen Erfolg einer Therapie bei einem/-r individuellen Patienten/-in vorherzusagen.“
Was die Diagnose der Erkrankung betrifft, sind etwa neuere Daten zum Vitamin-D-Spiegel im Blut, zu Anti-Myelin-Antikörpern oder L-Selektin viel versprechend, es ist aber noch mehr Evidenz erforderlich, um die Rolle und den möglichen Beitrag dieser Marker zum MS-Krankheitsgeschehen zu verstehen. Ein anderes Beispiel sind Entzündungsmarker in der Rückenmarksflüssigkeit, wie eine auf dem Kongress präsentierte Studie aus der Tschechischen Republik zeigt: Spiegel von Beta2-Mikroglobulin und Interleukin-8 waren in der Rückenmarksflüssigkeit von MS-Patienten deutlich höher als in einer Kontrollgruppe. Die Ergebnisse einer anderen Studie, die in Istanbul präsentiert wurde, weisen darauf hin, dass das Protein sIFNAR2 sich als weiterer diagnostischer MS-Biomarker etablieren könnte. Als ein neuer MS-Marker könnte sich zum Beispiel auch der Nachweis von Eisen im Gehirn mittels Magnetresonanz-Tomographie erweisen, wie eine auf dem Kongress vorgestellte Studie aus Graz belegt. Sie zeigte, dass im Gehirn von MS-Patienten/-innen vor allem in frühen Krankheitsphasen rasch zunimmt. „Die wissenschaftlichen Bemühungen zur Identifizierung von Entzündungsmarkern und neurodegenerativen Markern sollte sicher weitergeführt werden”, kommentierte Prof. Siva die jüngsten Ergebnisse.
Neurologen/-innen unterscheiden bei MS verschiedene Verlaufsformen – darunter den schubförmig remittierenden (RRMS), den primär-progredienten (PPMS) und den sekundär-progredienten (SPMS) Verlauf. Jede dieser Formen hat eine unterschiedliche Prognose und kann unterschiedliche therapeutische Ansätze erfordern. Einige der neuen bereits verfügbaren oder in Entwicklung befindlichen Biomarker könnten diese Unterscheidung oder die Einschätzung der Krankheitsprogression einfacher machen. “Neue Einsichten zur Gehirnatrophie und zur Wichtigkeit, die Krankheitsentwicklung anhand der Veränderungen des Gehirnvolumens zu beobachten könnten dazu beitragen, die klinischen Ergebnisse von MS-Patienten/-innen langfristig verbessern“, so Prof. Siva mit Verweis auf neuere Studien zu diesem Thema, die auf dem Kongress in Istanbul präsentiert wurden.
Hilfreich für die Therapiekontrolle
Zunehmend dienen Biomarker auch dazu, das Ansprechen auf die jeweils eingesetzte Therapie zu überwachen oder das Risiko wirksamer Therapien zu verringern. „Das sind wichtige Schritte in Richtung einer Personalisierung von MS-Therapien”, betonte Prof. Siva. Einige Beispiele für das Potenzial von Biomarkern in diesem Bereich: Ob ein Patient etwa auf den monoklonalen Antikörper Natalizumab anspricht, lässt sich anhand der Menge von Natalizumab beurteilen, die an einkernigen Zellen im peripheren Blut bindet. Ein Marker für die Chance, dass Cladribin die Krankheitsaktivität tatsächlich senken wird, ist das Ausmaß dieser Aktivität vor Behandlungsbeginn. Eine große, EU-geförderte Studie, die beim Kongress in Istanbul präsentiert wurde, belegt, dass im Blut nachweisbare Marker wie CD40L, Eotaxin oder IL-8 das Ansprechen auf eine Interferon-beta-Therapie vorhersagen können.
Eine Reihe der heute verfügbaren hochwirksamen Medikamente bergen auch Risiken – von der Bradykardie über immuninduzierte Schilddrüsenerkrankungen bis zur Progressiven Multifokalen Leukenzephalopathie (PML), einer gefährlichen Virusinfektion aufgrund der immunsuppressiven Wirkung mancher Medikamente. “Diese Substanzen sollten daher sehr gezielt nur bei Patienten/-innen eingesetzt werden, die auch einen Nutzen davon haben,” so Prof. Siva. „Wenn es uns zunehmend gelingt, Biomarker zu finden, die nicht nur die mögliche Effektivität eines Medikaments vorhersagen können, sondern auch die zu erwartenden Nebenwirkungen, kann man im Einzelfall Risiken und Nutzen viel besser gegen einander abwägen.“ So konnten etwa die Entdeckung von Antikörpern gegen das JC-Virus und die Einführung eines Antikörper-Index gegen das JC-Virus die Zahl der PML-Fälle bei MS-Patienten/-innen, die Natalizumab einnahmen, reduziert werden. Das zeigt einmal mehr eine in Istanbul präsentierte Studie, die den Nutzen eines soichen JCV-Antikörper-Index in der PML-Diagnostik zeigt.
Die zunehmende Forschung auf dem Gebiet der Molekularbiologie und Genetik, einschließlich von Technologien wie Genomik und Proteomik, und die intensive wissenschaftliche Beschäftigung mit microRNAs können wahrscheinlich neue Antworten und ein viel besseres Verständnis für die Pathophysiologie und das Management von MS liefern, so Prof. Siva.
Studien zu neuen und bewährten Substanzen
Die vielfältigen Möglichkeiten, eine frühe Diagnostik und die Verlaufskontrolle zu verbessern und individualisierter vorgehen zu können sei umso wichtiger, als sich die therapeutische Palette laufend erweitert, betonte Prof. Siva. „Viele neue Behandlungsoptionen sind in Entwicklung, und es gibt Grund für die optimistische Annahme, dass wir bald in der Lage sein werden, MS-Patienten/-innen noch rascher und wirksamer zu helfen.”
Auf dem Joint Congress of European Neurology wurden zahlreiche Studien zur Sicherheit und Wirksamkeit erst kürzlich zugelassener Substanzen wie Teriflunomid, Dimethylfumarat oder Alemtuzumab präsentiert. Andere Forschungsarbeiten beschäftigten sich vor allem mit der individualisierten Anwendung bewährter Therapien. Aufmerksam verfolgt wurden auch Ergebnisse zu in Entwicklung befindlichen monoklonalen Antikörpern wie Ofatumumab, Ocrelizumab or Daclizumab.
Quellen:
Kongress-Abstracts Myhr: MS: Results from current trials; Giovannoni: Biomarkers (including predictors/MRI); Comi: Future therapeutic strategies; Sörensen: Therapeutic antibodies in the treatment of MS; Scalfari, Understanding the natural history of MS progression; Stadelmann, Pathophysiology of progression; Hegen et al, Serum biomarkers predict IFNb treatment response in patients with multiple sclerosis; Khalil et al, Dynamics of brain iron accumulation differ between clinically isolated syndrome and multiple sclerosis: a longitudinal 3T MRI study; Pichler et al, Longitudinal changes of global and compartmental brain atrophy in patients with clinically isolated syndrome and clinically definite multiple sclerosis using 3-Tesla magnetic resonance imaging; Warnke et al, The CSF JCV antibody index for diagnosis of natalizumab-associated PML; Matejcikova, Cerebrospinal fluid inflammatory markers in patients with multiple sclerosis; Órpez-Zafra, Evaluation of sIFNAR2 as a potential diagnostic biomarker of multiple sclerosis
Pressestelle Joint Congress of European Neurology
B&K – Bettschart&Kofler Kommunikationsberatung
Dr. Birgit Kofler
Mobil: +43-676-63 68 930
E-Mail: kofler(at)bkkommunikation.com
Skype: bkk_Birgit.Kofler