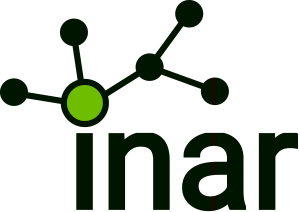Arten
Gleichstromlichtmaschine
Bis in die 1970er Jahre wurden Lichtmaschinen (http://www.gts-shop.de/Lichtmaschinen/) als Gleichstromgeneratoren ausgeführt. Im Stator wird durch die vom Erregerstrom durchflossenen Magnetspulen das Erregerfeld gebildet, in dem sich der Rotor dreht und dabei Wechselstrom erzeugt. Dieser wird durch den auf der Rotorwelle angeordneten Kollektor gleichgerichtet und über Kohlebürsten abgeleitet. Nachteilig ist dabei, dass die Kohlebürsten den vollen Ausgangsstrom des Generators übertragen müssen und daher relativ stark verschleißen. Zudem ist durch den Kollektor die maximal zulässige Drehzahl der Gleichstromlichtmaschine kleiner als die von Drehstromlichtmaschinen. Durch das geringere Übersetzungsverhältnis des Antriebs durch den Fahrzeugmotor ist die Folge, dass erst bei höherer Motordrehzahl nennenswerte elektrische Leistung produziert wird. Bei ungünstigen Betriebsbedingungen mit einer großen Anzahl von eingeschalteten elektrischen Verbrauchern und häufig niedrigen Drehzahlen führte das zur Entladung der Fahrzeugbatterie.
Vorteil der Gleichstromlichtmaschine ist, dass keine zusätzliche Gleichrichtung der erzeugten Spannung nötig ist. Das war vor der Verfügbarkeit von leistungsfähigen Halbleiterdioden ausschlaggebend für ihre Verwendung im Fahrzeugbau. Weiterhin kann sie ohne Steuerelektronik als Motor (http://www.gts-shop.de/Motor-Teilmotor/) zum Anlassen verwendet werden. In diesem Fall ist sie direkt mit der Motor- bzw. Turbinenwelle gekoppelt.
Gleichstromlichtmaschinen waren bis Ende der 1960er Jahre vorherrschend in PKW, LKW und Reisezugwagen. Heute findet man sie noch als Anlassgenerator an Flugzeugturbinen, kleinen Gasturbinen sowie in manchen Hybridfahrzeugen.
Wechselstromlichtmaschine
Einige Fahrzeughersteller wie z. B. Citroën in der 2CV statteten die Fahrzeuge mit Wechselstromlichtmaschinen aus.
Seit den 1970er Jahren haben sich Drehstromgeneratoren als Lichtmaschine (http://www.gts-shop.de/Lichtmaschinen/) durchgesetzt. Heute kommen dafür Klauenpolgeneratoren zum Einsatz. Gegenüber der Gleichstromausführung sind die Funktionen von Rotor und Stator vertauscht: Das Erregerfeld wird durch den Rotor erzeugt und induziert in den Spulen des Stators die dreiphasige Wechselspannung, die nach der Gleichrichtung dem Bordnetz zur Verfügung steht.
Gleichrichter
Der erzeugte Dreiphasenwechselstrom wird durch Leistungshalbleiter gleichgerichtet, die üblicherweise im Generator integriert sind. Seit ca. den 1990er Jahren sind Drehstromgeneratoren durch interne Hauptstromzenerdioden vor gefährlichen Überspannungen geschützt und damit auch für einen Betrieb ohne Batterie geeignet. Ältere Ausführungen ohne diesen Schutz mussten bei laufendem Motor stets mit der Fahrzeugbatterie verbunden sein, um Schäden an den Gleichrichterdioden zu verhindern. Da die maximale Sperrspannung der Gleichrichterdioden niedriger war als die Leerlaufspannung der unbelasteten Lichtmaschine, wurde die Fahrzeugbatterie mit ihrem geringen elektrischen Innenwiderstand als Puffer benötigt, um einen Durchschlag der Sperrschicht der Dioden und damit deren Zerstörung zu verhindern. Wichtig ist eine sichere elektrische Verbindung zwischen der Lichtmaschine und der Batterie. Schon korrodierte Anschlüsse führten häufig zu Ausfällen von Gleichrichterdioden.
Abfuhr der Verlustleistung
Die Wandlung der mechanischen Energie in elektrische erfolgt nicht verlustlos, ein Teil der Energie wird in Wärme umgesetzt. Bei ungenügender Wärmeabfuhr überhitzt das Aggregat und wird dabei zerstört.
Zur Abfuhr der Verlustleistung ist üblicherweise eine aktive Luftkühlung vorgesehen. Das zugehörige Lüfterrad befindet sich auf der Generatorwelle, entweder außen zwischen Riemenrad und Lichtmaschine, oder bei der Ausführung als Kompaktgenerator im Gehäuse selbst.
Bei manchen Fahrzeugen (z.B. Mercedes-Benz W210) ist der Generator mit einer Wasserkühlung ausgestattet. Das verbessert zwar die Kühlleistung immens, steigert jedoch auch Preis und Reparaturanfälligkeit. Eingesetzt wird dieses System im Verbund mit einem elektrischen Zuheizer, der ein schnelleres Erreichen der Kühlwassertemperatur gewährleisten soll. Dabei liefert der Generator die volle Leistung und heizt mit seiner Abwärme das Kühlwasser. Zusätzlich nimmt ein elektronisch geregeltes Heizelement die im System nicht benötigte Leistung auf, um die Heizleistung zu maximieren.