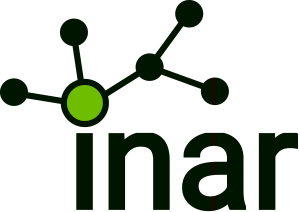EFNS/ENS Joint Congress of European Neurology: 31. Mai – 3. Juni 2014, Istanbul
Neue Wege in der Parkinson-Früherkennung wie Geruchstests oder transkranieller Ultraschall diskutierten Experten auf dem Joint Congress of European Neurology in Istanbul. Betont wurde auch die Bedeutung nicht-motorischer Symptome, insbesondere psychischer Begleiterkrankungen wie Depression, Schlafstörungen oder Spielsucht, die Betroffene massiv belasten.
Istanbul, 1. Juni 2014 – „Trotz 20 Jahren intensiver Forschung ist das Ziel noch nicht erreicht, Parkinsonkandidaten/-innen möglichst früh vor dem Krankheitsausbruch zu identifizieren. Wir müssen die Frühdiagnostik groß schreiben und dafür neue Wege einschlagen“, forderte Prof. Werner Poewe (Medizinische Universität Innsbruck) beim Joint Congress of European Neurology in Istanbul. „Wenn sich bei Parkinsonpatienten/-innen durch Zittern oder Steifigkeit die typischen ersten motorischen Zeichen ihrer Erkrankung zeigen, kann man mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass die zugrunde liegenden pathologischen Prozesse bereits Jahre zuvor völlig unbemerkt eingesetzt und viel Schaden angerichtet haben. Dafür verdichten sich in der Forschung die Beweise.“ Krankheitsmodifizierende oder neuroprotektive Maßnahmen in einem Frühstadium hätten ein deutlich größeres Potenzial, das Voranschreiten der Krankheit zu verlangsamen, als Interventionen in einem späten Krankheitsstadium.
Früherkennung durch Ultraschall, Biomarker und Geruchstests
Aktuell konkretisieren sich immer mehr innovative Verfahren, um die Früherkennung zu verbessern: In genomweiten Assoziationsstudien sind beispielsweise verschiedene Risikoallelen für Parkinson identifizieren worden. Auch bildgebende Verfahren könnten künftig das Auffinden von Risikopatienten/-innen unterstützen, berichtete Prof. Poewe. „Präklinische Störungen lassen sich durch funktionelle dopaminerge Bildgebungen sichtbar machen. Dafür wird der Dopamintransporter SPECT eingesetzt.“
Wie eine populationsbezogene prospektive Studie kürzlich nachgewiesen hat, lässt sich die Parkinson-Neigung auch mithilfe einer transkraniellen Ultraschalluntersuchung des Mittelhirns feststellen: Wird dabei Hyperechogenität festgestellt, besteht ein deutlich erhöhtes Risiko. Darüber hinaus gibt es Fortschritte im Bereich der Biomarker: „Derzeit werden proteomische Marker untersucht, die das Krankheitsrisiko anzeigen könnten. Außerdem häufen sich die Belege dafür, dass eine bestimmte Kombination aus Biomarkern in der Lage sein dürfte, Risikopatienten/-innen zu identifizieren. Diese könnten dann künftigen neuropräventiven Behandlungen zugeführt werden“, so der Experte.
Auch mit einfacheren Methoden ließe sich die Früherkennung verbessern, wie eine internationale Studie zeigt, die beim Neurologiekongress in Istanbul präsentiert wurde. Für die Untersuchung wurden 35 Menschen mit REM-Schlaf-Störungen einem Geruchstest unterzogen. Ein gestörter Geruchssinn erwies sich als Prädiktor einer Parkinson Erkrankung.
Fast jede/r zweite Parkinsonpatient/-in leidet an Depressionen
„Das zeigt einmal mehr, dass sich Diagnose und Behandlung nicht ausschließlich auf die typischen motorischen Parkinsonsymptome konzentrieren dürfen“, so Prof. Heinz Reichmann (Universitätsklinikum Carl Gustav Carus TU Dresden) beim Joint Congress of European Neurology. Symptome wie REM-Schlaf-Störungen, Riechverlust, Depressionen oder Darmträgheit können nicht nur auf ein Parkinson-Vorstadium hindeuten, sondern bleiben später oft als Begleiterkrankungen bestehen. „Darauf wird oft zu wenig geachtet, obwohl die Lebensqualität der Betroffenen erheblich darunter leidet“, konstatierte Prof. Reichmann. Einige Beispiele: Bis zu 90 Prozent der Parkinsonpatienten/-innen leiden unter Riechverlust, denn die Krankheit greift zu Beginn unter anderem den Riechlappen im Gehirn an. Bei 60 bis 98 Prozent der Patienten/-innen ist der nächtliche Schlaf gestört, vielfach auch erheblich, denn bei REM-Schlaf-Störungen verlieren die Betroffenen die Skelettmuskelatonie während der REM-Phase. Dadurch sind sie in der Lage, ihr Traumgeschehen körperlich auszuleben, was oft sehr unangenehm sein kann.
Auch neuropsychiatrische Probleme wie Angststörungen, Demenz oder Spielsucht sind verbreitete Komorbiditäten. Mindestens 40 bis 50 Prozent der Parkinson-Patienten/-innen leiden unter Depressionen, bei mehr als 30 Prozent treten diese vor den motorischen Symptomen auf. „Die Depression wird vor allem durch den Abbau jener Systeme ausgelöst, die die Monoamine-Neurotransmitter freisetzen, sowie durch eine Fehlfunktion des Stirnlappens und der Gehirnrinde. Forschungsergebnisse aus der Neuropathologie zeigen einen Verlust von Neuronen im Nucleus coeruleus, bei manchen Patienten/-innen auch in den Raphe-Kernen – womit die Depression eindeutig nicht nur Folge reaktiven Verhaltens ist“, so Prof. Reichmann. Zudem unterscheidet sich Depression bei Parkinson deutlich von anderen Formen: Sie macht sich bei jedem dritten Betroffenen vor den motorischen Symptomen der Krankheit bemerkbar, etwa durch Verlust von Unternehmergeist und Selbstwertgefühl oder andere Frühsymptome.
Später sind Panikattacken und Ängste häufig, wobei die Stimmungsschwankungen nur schwach mit dem Schweregrad der motorischen Beeinträchtigung korrelieren. „Betroffene sollten unbedingt in geeigneter Weise unterstützt werden. Psychosoziale Angebote, Psychotherapie, Verhaltenstherapie oder Medikamente haben sich bewährt“, so Prof. Reichmann. Als spätere nicht-motorische Störungen sind Harninkontinenz, sexuelle Dysfunktionen, starkes Schwitzen, Abgeschlagenheit, Apathie oder Psychosen verbreitet. „Es ist höchste Zeit für neue, ganzheitliche Behandlungsoptionen, um Parkinson-Patienten/-innen besser und schneller helfen zu können“, forderte der Experte.
Quellen:
Kongress-Abstracts Poewe, Early diagnosis and biomarkers in PD; Mahlknecht et al., Olfactory assessment for predicting transition to neurodegenerative parkinsonian disorders in subjects with idopathic rapid-eye-movement sleep behavior disorder: a prospective cohort study; Reichmann, Movement disorders moving beyond the motor phenotype.
Pressestelle Joint Congress of European Neurology
B&K – Bettschart&Kofler Kommunikationsberatung
Dr. Birgit Kofler
Mobil: +43-676-63 68 930
E-Mail: kofler@bkkommunikation.com
Skype: bkk_Birgit.Kofler