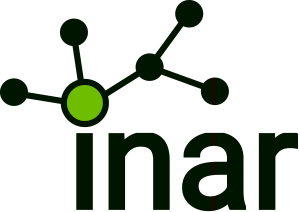Ungeachtet ihrer Häufigkeit werden Nierenerkrankungen zu wenig als
weitreichendes medizinisches und gesundheitspolitisches Problem wahrgenommen,
kritisierten Experten/-innen beim European Health Forum Gastein (EHFG). Denn
Patienten/-innen mit terminalem Nierenversagen, die entweder mittels Dialyse vor
dem Tod gerettet werden können oder eine Nierentransplantation benötigen,
stellen nur die Spitze des Eisbergs dar. Die Lebendspende kann die Wartezeit auf
eine Spenderniere verkürzen und bringt viele Vorteile. Altbundeskanzler Dr.
Franz Vranitzky berichtet auf dem EHFG über seine Erfahrungen mit der
Lebendspende.
Bad Hofgastein, 4. Oktober 2012 – Geschätzte 250.000
Menschen in der EU leiden an einem terminalen Nierenversagen, sind also auf eine
Dialyse oder Transplantation angewiesen. In Österreich leben mehr als 4.000
Menschen dank regelmäßiger Dialyse, noch einmal so viele haben eine gespendete
Niere, berichtet Prim. Univ.-Prof Dr. Erich Pohanka (AKH Linz), Präsident der
Österreichischen Gesellschaft für Nephrologie (ÖGN), beim EHFG. In der
Öffentlichkeit, aber auch seitens der Gesundheitspolitik gibt es eine Tendenz,
im Zusammenhang mit Nierenerkrankungen nur diese relativ kleine Gruppe
Betroffener wahrzunehmen, kommentiert der ÖGN-Präsident bei einer von ihm
präsidierten Veranstaltung: „Doch das ist nur die Spitze des Eisbergs.“
„In Europa haben rund zehn Prozent der Bevölkerung eine zumindest leicht
eingeschränkte Nierenfunktion. Das sind etwa 50 Millionen Menschen in der EU, in
Österreich 800.000“, so Univ.-Prof. Dr. Alexander Rosenkranz (Leiter der
Klinischen Abteilung für Nephrologie, MedUni Graz). „Schon angesichts der
demographischen Entwicklung – Niereninsuffizienz nimmt mit dem Alter zu –
bedeutet das eine vielfach unterschätzte Herausforderung für die
Gesundheitssysteme. Aufklärung ist hier ebenso notwendig wie gezielte
Präventionsstrategien.“
Eines der Probleme des „stillen Leidens“ Nierenschwäche: Symptome treten oft erst nach jahrzehntelanger Erkrankung auf, weshalb die schlechter werdende Funktion der Niere von Betroffenen nicht bemerkt und häufig auch nicht diagnostiziert wird. Doch auch eine leichte Niereninsuffizienz ist nicht harmlos, warnt Prof. Rosenkranz. „Bei einer Nierenfunktionseinschränkung von mehr als 50 Prozent sind etwa Dosierungseinschränkungen bei verschiedenen Medikamenten zu beachten. Und eine Nierenschwäche wirkt sich ungünstig auf das Herz-Kreislauf-System aus. Da die Erkrankung der Nieren meist das Ergebnis von Bluthochdruck und Diabetes ist, geraten die Betroffenen in einen Teufelskreis von Risikofaktoren.“
Menschen mit eingeschränkter Nierenfunktion sterben daher auch deutlich
häufiger an kardialen Ursachen oder einem Schlaganfall als Nierengesunde – in
vielen Fällen lange bevor ihre Nierenerkrankung offensichtlich wird. Die
European Kidney Health Alliance fordert daher auch ein gezieltes Screening von
Patienten/-innen mit einem hohen Risiko, eine Niereninsuffizienz zu entwickelt,
also zum Beispiel Personen mit hohem Blutdruck und/oder Diabetiker/-innen.
Gemeinsame Entscheidung für die optimale Therapie
Bei einem Teil der Betroffenen schreitet die Nierenkrankheit bis zum
terminalen Nierenversagen fort. Für sie wird eine Nierenersatztherapie – also
entweder Hämodialyse, Peritonealdialyse oder Nierentransplantation – notwendig.
Die Transplantation kommt, so Prof. Rosenkranz, für rund ein Viertel der
Patienten an der Dialyse in Frage, weil bestimmte Begleiterkrankungen
ausgeschlossen werden müssen. Prof. Rosenkranz: „Vor Beginn der Therapie müssen
die Patienten/-innen über die Therapiemöglichkeiten ausführlich aufgeklärt
werden. Auf dieser Basis soll eine gemeinsame Entscheidung über die im
individuellen Fall optimale Form der Nierenersatztherapie getroffen werden. Hier
müssen sowohl persönliche Aspekte, als auch medizinische Notwendigkeiten
einfließen.“
Transplantation hat medizinischen und gesundheitsökonomischen
Nutzen
Nierenversagen stellt nicht zuletzt auch eine erhebliche Belastung für die
Gesundheitssysteme dar. Bereits jetzt fließen in Europa mindestens zwei Prozent
der Gesundheitsbudgets in Dialyse und Nierentransplantation. Nach Angaben der
European Kidney Health Alliance könnte dieser Wert in den kommenden Jahren gegen
fünf Prozent gehen.
„Die Transplantation ist sowohl was Lebensqualität, Lebenserwartung als auch
Kosten betrifft den anderen Nierenersatztherapien überlegen“, betont Prim.
Univ.-Prof. Dr. Rainer Oberbauer (Krankenhaus der Elisabethinen, Linz). Eine
rezente Kostenanalyse in Österreich zeigt ab dem zweiten Jahr deutlich
niedrigere Behandlungskosten im Vergleich zur Dialyse – bei deutlich
verbesserter Lebensqualität der Transplantationspatienten/-innen. Prof.
Oberbauer: „Die medianen jährlichen Therapiekosten für Patienten/-innen an der
Hämodialyse betragen in Österreich etwa 44.000 Euro in den ersten zwölf Monaten
und bleiben danach in ungefähr diesem Bereich. Im Gegensatz dazu sind nach einer
Transplantation die Kosten im ersten Jahr mit etwa über 50.000 Euro etwas höher,
gehen danach aber auf weniger als die Hälfte zurück. Ab dem dritten Jahr nach
der Transplantation betragen die jährlichen Behandlungskosten durchschnittlich
13.000 Euro pro Jahr, das ist also weniger als ein Drittel der Kosten, die durch
Hämodialyse entstehen würden, und das bei deutlich besserer Lebensqualität.“
Eine entscheidende Voraussetzung für die Transplantationsmedizin ist
allerdings die Verfügbarkeit von Spenderorganen. Auf Grund der
durchschnittlichen Wartezeit von drei Jahren soll in Zukunft die Lebendspende
weiter gefördert werden. Derzeit kommen in Österreich nur rund zehn Prozent der
transplantierten Nieren von Lebendspendern/-innen, in Norwegen sind es schon 80
Prozent. Das hat Vorteile, die über die Verfügbarkeit von Organen hinausgehen,
so Prof. Oberbauer: „Die Überlebensraten von Patienten/-innen und Transplantaten
sind bei einer Lebendspende deutlich besser als nach konventioneller
Nierentransplantation.“
Alt-Bundeskanzler Dr. Franz Vranitzky berichtete auf der
EHFG-Veranstaltung über seine persönlichen positiven Erfahrungen mit einer
Lebendspende.
Gesetzliche Regelung über Organtransplantation wird
überarbeitet
„In Folge der EU-Richtlinie über Qualitäts- und Sicherheitsstandards für zur
Transplantation bestimmte menschliche Organe muss in Österreich die gesetzliche
Regelung über Organtransplantation überarbeitet werden“, berichtet Dr. Maria
Kletecka-Pulker (Institut für Ethik und Recht in der Medizin, MedUni Wien).
Dieses neue Organtransplantationsgesetz (OTPG) wird derzeit begutachtet und
erhält erstmals explizite rechtliche Regelungen für eine Lebendspende.
„Organe dürfen nur freiwillig und unentgeltlich gespendet werden. Dies
schließt aber nicht aus, dass der Spender eine angemessene Entschädigung für
Verdienstentgang und andere angemessene Ausgaben bekommt“, zitiert Dr.
Kletecka-Pulker zentrale Passagen des Gesetzesentwurfes. Da es sich bei der
Entnahme der Niere nicht um einen medizinisch indizierten Eingriff handelt, ist
eine umfassende ärztliche Aufklärung verpflichtend, auf die der Spender auch
nicht verzichten kann. Für den Empfänger stellt die Transplantation im Gegensatz
zum Spender einen medizinisch notwendigen Eingriff dar, der sich nach den
allgemeinen Regelungen richtet: So ist für die Durchführung der Transplantation
die Einwilligung der Patienten/-innen und die medizinische Indikation
erforderlich. Liegt eine der Voraussetzungen nicht vor, darf der Eingriff nicht
durchgeführt werden, denn Patienten/-innen können eine medizinische Maßnahme
ablehnen. Dr. Kletecka-Pulker: „Selbstverständlich muss auch der Empfänger
umfassend ärztlich etwa hinsichtlich der Risiken aufgeklärt werden.“
Das EHFG ist der wichtigste gesundheitspolitische Kongress der Europäischen
Union, mehr als 600 Entscheidungsträger aus 45 Ländern diskutieren vom 3. bis 6.
Oktober 2012 bereits zum 15. Mal zentrale Zukunftsthemen der europäischen
Gesundheitssysteme.
Fotos zum diesjährigen European Health Forum Gastein finden Sie unter http://www.ehfg.org/940.html.
EHFG Pressebüro
Dr. Birgit Kofler
B&K Kommunikationsberatung GmbH
Tel. während des Kongresses: +43 6432 3393 239
Mobil: +43 676 636 89 30
Tel. Büro Wien: +43 1 319 43 78 13
E-Mail:presse@ehfg.org