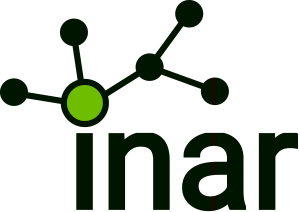Das “Ikea-Syndrom”: sollen wir zusammenziehen?
Die gemeinsame Wohnung als Spiegelbild der Beziehung
DAS IKEA-SYNDROM: SOLLEN WIR ZUSAMMENZIEHEN?
Das Wunderbare ist geschehen! Obwohl es heute eigentlich keine vernünftigen oder zwingenden Gründe mehr gibt, sich in so etwas wie eine Liebesbeziehung zu stürzen, haben sich zwei gefunden. Und nicht nur das: Sie wollen sogar das Risiko eingehen, ihren Lebensmittelpunkt zu teilen. Die gemeinsame Wohnung ist ein riesengroßer Meilenstein in jungen Beziehungen und bedeutet sehr viel. Für ganz junge Paare ist sie ein Experimentierfeld in Sachen „Zusammenleben“, man probiert aus, wie man sich selbst wahrnimmt und verändert, wenn der Alltag zur Gewohnheit wird. Neue Modelle von Partnerschaft warten darauf ausprobiert, bewährte warten darauf, getestet zu werden. Gleichzeitig lockt die Vorstellung, mit dem geliebten Partner ständig zusammen zu sein, ihn vorzufinden, wenn man nach Hause kommt, jede Nacht zusammen einschlafen zu können: Für Menschen, die sehr verliebt sind, ist das eine unwiderstehliche Vorstellung!
Erprobte neue Paare sehen die Sache mit dem Zusammenziehen oft etwas vorsichtiger. Sie wissen schon genauer, was sie wollen – und was nicht! Ihr Geschmack ist geprägt, ihre Vorlieben formuliert. Das fängt bereits mit der Auswahl der Viertels an, in dem man wohnen möchte – oder eben keinesfalls. „Man“ wohnt nicht in Viertel x oder Stadtteil y. Eine Wohnung im Quartier „Z“ ist dagegen vielleicht erstrebenswert und verlockend. Weiterhin bestimmen andere Faktoren die Entscheidung. Entfernung zum Arbeitsplatz, zu Familie oder Freunden; die Möglichkeit, lieb gewonnene Ziele in der Umgebung weiterhin aufsuchen zu können: Stammkneipe, Friseur, Lieblingsbäcker. Ganz unromantisch wird die Aussicht auf Zweisamkeit gegen solche Erwägungen abgewogen. Und dann die Wohnung selbst: Zieht man in seine, in ihre Wohnung oder sucht man „tabula rasa“ – etwas ganz Neues? Hat „er“ oder „sie“ womöglich eine Einliegerwohnung bei den Eltern oder auf deren Grundstück gebaut? Leben andere Familienmitglieder mit unter einem Dach? Mit der Entscheidung für eine gemeinsame Basis gewinnen wir viel: vom materiellen Vorzug, nur noch eine Miete zahlen und nicht mehr fahren zu müssen um den anderen zu sehen über halbierte Hausarbeit und die Möglichkeit zur Aufgabenteilung und zum Gespräch (auch mitten in der Nacht) geben wir mit unseren vier Wänden auch vieles auf. Souveränität, Rückzugsmöglichkeiten, volles Bestimmungsrecht über Raum und Zeit.
Und ist schließlich die Wohnung gefunden, fragt man sich: Wie soll sie aussehen, die gemeinsame Bleibe?
Hier sind es oft Frauen, die den gemeinsam bewohnten Quadratmetern ihren eigenen Stil aufdrücken wollen. Der erste gemeinsame IKEA- Besuch ist inzwischen zum Synonym für „jetzt wird es ernst“ geworden. Beim ersten Besuch noch lächelnd und voller Großmut taxiert man gemeinsam die Angebote. Manche denkt beim Betrachten der Regalserie “Groben” “Iih, wie gruselig! Naja, das kriegen wir schon noch hin, ich erzieh´ihn mir schon noch”, während er arglos nach praktischen Möbeln sucht, die einfach ihren Zweck erfüllen sollen. Charakteristisch sind bei den ersten IKEA-Besuchen die Spaßkäufe. Nichts Ernstes landet im Einkaufswagen, höchstens ein paar Duftkerzen (bei denen nun er denkt “Iiih, wie eklig. Muss ich mich daran jetzt gewöhnen?”) oder einem Postkartenset oder einer Klemmleuchte. Geht es um die erste gemeinsame Einrichtung wird mit wesentlich härteren Bandagen gekämpft. Sie, die sich schon seit Wochen mit dem Einrichten beschäftigt hat und sich freut, statt der kleinen nun endlich eine größere Wohnung einrichten zu dürfen, übernimmt recht forsch die Führung und sein Protest “Meinst du ehrlich? Grüne Bettwäsche?” wird immer leiser. Resigniert stapelt er die Bettwäsche zu den Kronleuchterimitaten und den Audrey-Hepburn-Postern in den Wagen. An der praktischen Regalserie “Groben” kommen sie diesmal seltsamerweise gar nicht vorbei.
Mit dem Vorurteil „Du hast doch eh kein Gespür für Einrichtung“ übernimmt sie die Einrichtung, das Styling, die Ordnung und Aufteilung; Struktur und Funktion liegen in ihrer Hand. Im schlimmsten Fall führt das zu geblümten Schnörkelsofas, rosa-weiß gemusterten Teppichen und einer nicht nachvollziehbaren, aber penibelst einzuhaltenden Einsortierordnung für die Spülmaschine. „Mein Reich“ scheint dieses Territorialverhalten zu sagen. Viele Männer ziehen sich dann auf die Dauer in die damit angebotene Resignation zurück. Lieber ein unordentlicher Schluffen sein, als sich um ungeliebte Aufgaben auch noch streiten müssen. „Wenn ich es nicht gut genug mache, soll sie es halt selber erledigen!“ Frauen stellen sich damit manchmal selbst eine Falle. Indem sie die Aufgaben übernehmen, weil er es “ja nicht kann” haben sie die Erledigung nun künftig auf der to-do-Liste. Was danach folgt, ahnt man fast: Natürlich ist sie zu recht sauer, wenn er seinen Aufgaben nicht nachkommt, Stufe 2 der Eskalation ist erreicht. In diesen Scharmützeln verbringen Paare oft Jahrzehnte ihres Lebens zu und diese Streitigkeiten funktionieren nur bei Paaren. In einer WG hätte man längst eine Regelung gefunden.
Ähnlich sieht es mit der legendären Möblierungsfrage aus. Mein Ex-Mann brachte einen bunt lackierten, kniehohen Indianer mit in die erste Wohnung. Dieser Indianer hatte eine Hand über den Augen gelegt um sich gegen das gleißende Licht der Steppe Nevadas zu schützen und blickte streng in die Ferne. Ein tolles Deko-Teil – für ein Motel oder eine Frittenhütte an der Route 66, aber nicht in meinem Wohnzimmer. So wurde der Ärmste zum Wanderindianer. Er wanderte vom Wohnzimmer hinter eine Zimmerpflanze im Flur. Dieser Platz gefiel meinem Exmann aber nicht und der Indianer landete im Schlafzimmer. Dort bekam ich Alpträume und verbannte das gute Stück ins Bad. Dort litt er unter Feuchtigkeit. (Indianer sind da empfindlich). Kurz: Der Indianer musste bleiben. Und irgendwann verstand ich auch, wieso: Zusammenziehen heißt auch, die seltsamen Schrullen und Zumutungen des Partners anzunehmen. Sie ihm nicht wegtrainieren oder verleugnen zu wollen, sondern zu erkennen, dass er deshalb so gut ist, weil er auch diese Seiten hat. Und das bedeutet, dass ich mir weder die Version meiner Wohnung noch die Version meiner Beziehung zu 100% selbst aussuchen kann. Insofern ist die gemeinsame Wohnung ein Spiegelbild der Beziehung. Gemeinsamkeiten neben Unvereinbarkeiten zu ertragen, kein auf Glanz gebürstetes gemeinsames Konzept, sondern immer wieder die Spannung zweier grundverschiedener Individuen aushalten – und genießen zu können. Einen Mann, der auf geblümten Teppichen wohnt, einen farblich passenden Sofaüberwurf hat und sein Getränk auf Eulenuntersetzern abstellt, bevor er die Schuhspanner in die blank polierten Stiefel steckt, wollten die meisten Frauen doch gar nicht. Und eine Frau, die alleine herrscht und den Mann als Partner zum Deko-Artikel für sich und ihre Wohnung betrachtet, ebenfalls nicht. Auf der anderen Seite brauchen anscheinend viele Männer Anleitung in Pflege. Wie geht das, eine Beziehung, ein Zuhause pflegen, um der Schönheit und es Glanzes willen? Wie kann ich für mich, meine Partnerin, meine Umgebung sorgen? Paare ziehen zusammen, weil sie lernen und wachsen wollen. Weil sie den Umgang mit sich selbst und dem anderen trainieren wollen. Weil sie die Herausforderung durch einen anderen Menschen annehmen wollen. Sie wollen „neins“ hören und sie wollen streiten, um ihr Wachstum und ihr Glück ringen. So entsteht langsam aber sicher ein gemeinsamer Raum, ein „wir“, das Raum für Zumutungen und Unverständliches lässt, das Toleranz und Weitblick fordert und dafür echte Geborgenheit und Freiheit zugleich bietet.