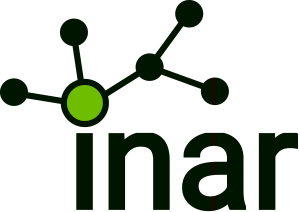EFNS/ENS Joint Congress of European Neurology: 31. Mai – 3. Juni 2014, Istanbul
Im Rahmen des Joint Congress of European Neurology in Istanbul präsentierten Forscher aus Österreich und Belgien eine Studie zu innovativen Methoden, mit Koma-Patienten/-innen in Kontakt zu treten. Ziel ist es, anhand der aufgezeichneten Gehirnströme auch mit nur eingeschränkt bewussten Menschen kommunizieren zu können.
Istanbul, 3. Juni 2014 – Die direkte Kommunikation des menschlichen Gehirns mit einem Computer ist ein altes Science Fiction Motiv, das gegenwärtig vor seiner Realisierung stehen könnte. Profitieren sollen davon Menschen, die aufgrund schwerer Behinderungen nicht mehr in der Lage sind, mit ihrer Umwelt in Kontakt zu treten. „Das sind in der Regel Patienten/-innen, die ein Koma überlebt haben und sich entweder in einem Zustand mit eingeschränktem Bewusstsein befinden, oder ein sogenanntes Locked in Syndrom zeigen“, sagt Prof. Steven Laureys von der Coma Science Group der Université de Liège auf dem Joint Congress of European Neurology. Beim Locked in Syndrom besteht eine vollständige Lähmung des Körpers inklusiver der für das Sprechen notwendigen Muskulatur bei vollem Bewusstsein. Bei allen diesen Menschen kann man, ebenso wie bei Gesunden, die Gehirnströme messen. Das Elektroenzepahlogramm (EEG) ist eine harmlose und schmerzfreie Prozedur. Wo im Gehirn welche Ströme fließen, lässt sich bis zu einem gewissen Grad willentlich steuern. Denken wir zum Beispiel daran, unseren Arm zu heben, so entspricht das einem elektrischen Signal an einer bestimmten Stelle des Gehirns – und zwar zumindest theoretisch unabhängig davon, ob wir tatsächlich in der Lage sind, den Arm zu heben. Dieses Potential kann man nun messen und als Signal für die Kommunikation verwenden. Noch ausgefeilter aber im klinischen Alltag schwerer umsetzbar ist Aufzeichnung der Gehirnaktivität mittels funktioneller Magnetresonanztomographie (fMRI).
Schwierige Kontaktaufnahme
Die Methode zeigt erste Erfolge, doch die Probleme beginnen bereits bei der Kontaktaufnahme. Viele der Betroffenen können schlecht sehen, andere schlecht hören oder sie sind überhaupt auf ihren Tastsinn angewiesen. Die Forscher der Universität Graz und der Université de Liège erprobten daher sowohl akustische als auch taktile Reize sowie motorische Vorstellung – Patienten/-innen stellen sich vor, den Arm zu bewegen. Das akustische Verfahren erfüllt dabei zunächst den Zweck, festzustellen, ob der/die Patient/-in überhaupt so weit bei Bewusstsein ist, dass eine Kommunikation möglich werden könnte. Die anderen beiden Zugänge sind direkt zur Kommunikation geeignet. Bei gesunden Probanden/-innen konnte mit diesen Methoden eine Zuverlässigkeit von rund 80 Prozent erreicht werden. Die restlichen 20 Prozent kommen beispielsweise durch individuelle Unterschiede im EEG der Probanden/-innen zustande.
Erste Studien laufen
Prof. Laureys: „Am einfachsten ist es, ‚ja‘ zu sagen, indem man sich beispielsweise auf seinen linken Arm konzentriert. In einem weiteren Schritt kann man das Vokabular dann auf ‚ja‘ und ‚nein‘ erweitern. Schließlich gelingt es auch, auf diesem Weg einen Cursor zu steuern. Unsere Hoffnung ist, dass es mit dieser Methode auch möglich werden könnte, zum Beispiel einen Rollstuhl zu manövrieren. Derzeit liegt eine wichtige Einschränkung jedoch darin, dass die Experimente zwar mit gesunden Probanden/-innen bereits ausgezeichnet klappen, bei neurologisch schwer geschädigten Patienten/-innen jedoch auf zusätzliche Probleme stoßen. Beispielsweise haben diese Menschen oft Probleme, sich über längere Zeit zu konzentrieren oder sind intellektuell eingeschränkt.“ Dennoch haben erste Studien mit Patienten/-innen bereits begonnen. Diese werden vor allem von Personen mit Locked in Syndrome sehr gut aufgenommen, weil die verschiedenen Aufgaben und Tests für sie eine gewisse Abwechslung vom Krankenhausalltag bedeuten. Bei nur eingeschränkt bewussten Patienten/-innen stehen die Experten vor größeren Schwierigkeiten. So kann es im Einzelfall schwierig sein, zwischen bewussten Reaktionen und zufälligen Phänomenen im EEG zu unterscheiden.
Quellen:
Kongress-Abstract Espinosa et al., A multimodal BCI for communication and assessment of consciousness in non-responsive patients
Pressestelle Joint Congress of European Neurology
B&K – Bettschart&Kofler Kommunikationsberatung
Dr. Birgit Kofler
Mobil: +43-676-63 68 930
E-Mail: kofler@bkkommunikation.com
Skype: bkk_Birgit.Kofler