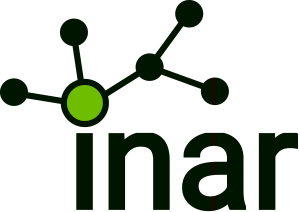EFNS/ENS Joint Congress of European Neurology: 31. Mai – 3. Juni 2014, Istanbul
Patienten/-innen mit rezidivierendem Gehirntumor leiden im Alltag zwar unter Funktionsstörungen, sehen sich jedoch psychisch weniger stark belastet als Menschen, die von anderen Krebserkrankungen betroffen sind. Pflegende Angehörige von Gehirntumorpatienten/-innen gehen für Familienmitglieder an ihre Grenzen, gewinnen aber auch an Selbstvertrauen. Beim Joint Congress of European Neurology in Istanbul lieferten aktuelle Studien neue Einblicke in die Lebensqualität von Patienten/-innen und pflegenden Angehörigen.
Istanbul, 3. Juni 2014 – Ein bisher wenig untersuchter Aspekt der Gehirntumorforschung betrifft die Lebensqualität und psychische Verfassung von Betroffenen und pflegenden Angehörigen. Dr. Alessandra Petruzzi (Fondazione Istituto Neurologico „Carlo Besta“, Mailand) präsentierte beim Joint Congress of European Neurology in Istanbul zwei aktuelle Studien ihres Forschungsteams, die ein teilweise völlig neues Licht auf die Situation der Patienten/-innen und deren Angehörigen werfen.
Reaktionen auf rezidivierenden Gehirntumor
Eine Studie widmet sich den psychologischen Mustern, die bei Patienten/-innen mit rezidivierendem Gehirntumor auftreten. Wie gehen sie mit der Tatsache um, dass der Tumor trotz aller Bemühungen nicht besiegt ist? 81 Patienten/-innen wurden mithilfe verschiedener Tests und Fragebögen hinsichtlich psychischer Belastung, Angst und Depression untersucht. Gleichzeitig wurde auch ihr funktioneller Status erhoben und somit der Grad ihrer krankheitsbedingten Alltagseinschränkungen bei Aktivität, Selbstversorgung und Selbstbestimmung erfasst.
„Die Ergebnisse sind erstaunlich und scheinen auf den ersten Blick widersprüchlich“, erklärte Dr. Petruzzi. Die Studienteilnehmer/-innen litten im Vergleich zu Patienten/-innen mit primären Gehirntumoren unter deutlich größeren Funktionseinschränkungen im Alltag. Auch um ihr soziales und familiäres Wohlbefinden war es wesentlich schlechter bestellt. Dass ein Rezidiv diagnostiziert wurde, schien zwar die Angst der Betroffenen nicht weiter zu erhöhen, sie reagierten allerdings mit größerer Niedergeschlagenheit darauf als Personen in Vergleichsgruppen. „Trotz alledem wiesen sie im Vergleich zu Patienten/-innen mit anderen Tumorerkrankungen eine signifikant geringere psychische Belastung auf. Völlig überraschend zeigte sich weiters, dass die Patienten/-innen der Testgruppe einen mit Abstand besseren Durchschnittswert beim emotionalen Wohlbefinden hatten als Patienten/-innen mit primärem Gehirntumor“, führte Dr. Petruzzi aus.
Die Expertin interpretierte die Studienergebnisse folgendermaßen: „Der Umstand, dass ein Gehirntumor erneut auftritt, kann eine größere Rolle für den Zustand der Patienten/-innen spielen als die tatsächlichen Funktionseinschränkungen selbst. Die psychologische Reaktion darauf ist verständlicherweise stark. Die Trennung zwischen der fast durchgängig als schlecht befundenen Lebensqualität einerseits und der als gering eingestuften psychischen Belastung andererseits ist das sicherlich verblüffendsten Resultat dieser Studie. Es lässt den Schluss zu, dass die Betroffenen im emotionalen Bereich immer noch extrem gut konservierte Bewältigungsstrategien abrufen können, während sie ihre sonstige Situation klar zu beurteilen vermögen und über ihre Krankheit gut Bescheid wissen.“
Wie geht es pflegenden Angehörigen von Gehirntumor-Patienten/-innen?
In einer weiteren Studie untersuchte ein Forschungsteam unter Dr. Petruzzis Ägide Lebensqualität und Wohlbefinden pflegender Angehöriger von Gehirntumorpatienten/-innen. Diese müssen damit zurechtkommen, einen nahestehenden Menschen durch alle Phasen eines potenziell kurzen Krankheitsverlaufs zu begleiten, der für den Betroffenen schwerwiegende funktionale, kognitive und psychologische Folgen haben kann und im schlechtesten Fall tödlich endet. Untersucht wurden dafür 100 Menschen, deren Angehörige in der Neuroonkologie der Fondazione Istituto Neurologico „Carlo Besta“, Mailand, behandelt wurden.
Die Studienergebnisse zeigen, dass pflegende Angehörige deutliche Abstriche in der Lebensqualität in Kauf nehmen müssen. Vor allem ihre seelische Gesundheit ist angeschlagen: Sie leiden signifikant häufiger unter Ängsten und depressiven Verstimmungen. Ihre Belastung zeigt sich hauptsächlich darin, dass ihre Fähigkeit zu Pflegen zunehmend nachlässt und ihre Kraft erlahmt. Viele berichten davon, dass sich auch ihre finanziellen Mittel mit der Zeit erschöpfen. Nichtsdestotrotz reagieren die pflegenden Angehörigen mit einer bemerkenswert positiven körperlichen Energie auf die Krankheit ihres Familienmitglieds. Notwendigkeit und Wille, einem nahestehenden Menschen in einer Ausnahmesituation zu helfen, stärkt das Selbstbewusstsein der pflegenden Angehörigen.
„Besonders aufschlussreich war die Tatsache, dass sich die Lebensqualität Pflegender nicht maßgeblich je nach dem Grad der Tumorerkrankung unterscheidet. Sie legt den Schluss nahe, dass bei besorgten Familienmitgliedern die Diagnose ‚Gehirntumor‘ zu einem Leben führt, das gedanklich überwiegend vom Konzept einer unheilbaren Krankheit bestimmt wird. Differenzierungen nach besseren oder schlechteren Heilungschancen scheinen daneben keinen Platz zu haben“, fasste Dr. Petruzzi zusammen. „Beide Studien weisen klar darauf hin, dass bei der Diagnose Gehirntumor ein ganzheitlicher Ansatz verfolgt werden muss, der die psychische Gesundheit der Betroffenen und Familienangehörigen einschließt“, betonte die Expertin. Pflegende Angehörige bräuchten neben psychologischer Unterstützung auch die nötigen Hilfestellungen bei praktischen Dingen des Alltags, sei es bei der Beschaffung eines Krankenbettes für die häusliche Pflege oder bei der Erhaltung des Arbeitsplatzes, um Pflege und Job vereinbaren zu können.
Quellen:
Kongress-Abstracts Petruzzi et al, Psychological patterns of patients; Petruzzi et al, What about caregivers of brain tumor patients? Focus on psychological reactions to the illness.
Pressestelle Joint Congress of European Neurology
B&K – Bettschart&Kofler Kommunikationsberatung
Dr. Birgit Kofler
Mobil: +43-676-63 68 930
E-Mail: kofler@bkkommunikation.com
Skype: bkk_Birgit.Kofler