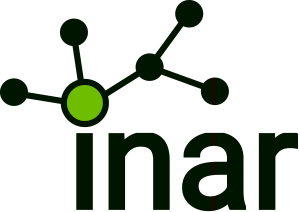FAKT 1: AB 2 WOCHEN SOLLTE MAN ZUM ARZT GEHEN
Rückenschmerzen zählen mit zu den häufigsten Beschwerden in Deutschland. Die meisten Rückenschmerzen sind harmlos und verschwinden nach wenigen Tagen.
Halten die Schmerzen jedoch länger als 2 Wochen an, sind sehr intensiv oder kommen immer wieder, sollte ein Arzt aufgesucht werden.
Auch funktionelle Einschränkungen wie ein Taubheitsgefühl in den Fingern, Händen, Armen oder Beinen zusätzlich zu den Rückenschmerzen oder ein verminderter Bewegungsumfang (z.B. sich nicht mehr aufrichten können) sind Anzeichen für eine ernstere Ursache der Schmerzen und sollten ärztlich untersucht werden.
Treten die Rückenschmerzen in Verbindung mit einem Unfall auf, ist unbedingt umgehend der Arzt aufzusuchen.
Viele verschiedene Ärzte und Therapeuten befassen sich mit dem Problem Rückenschmerz.
Zu den am häufigsten aufgesuchten zählen Allgemeinmediziner, Orthopäden, Neurologen, Schmerztherapeuten, Physiotherapeuten und auch Onkologen. Je nach Fachrichtung kann die Diagnostik, aber vor allem die empfohlene Therapie der Rückenschmerzen variieren.
FAKT 2: DREI WESENTLICHE ZIELE DER DIAGNOSTIK VON RÜCKENSCHMERZEN
Die Diagnostik der Rückenschmerzen hat drei Ziele, die wie folgt in den nationalen Leitlinien zum Kreuzschmerz festgelegt sind.
Aufdecken der Ursachen der Beschwerden, insbesondere wenn diese einer spezifischen oder gar dringlichen Behandlung bedürfen
Objektivierung der Beschwerden und der daraus resultierenden Funktionsstörungen als Grundlage für die Verlaufsbeobachtung
Aufdecken von Faktoren („yellow flags“), die ein Risiko für die Chronifizierung des Schmerzbildes bergen.
FAKT 3: ZUERST KOMMT DIE SCHMERZANAMNESE
Die Diagnostik (Gesamtheit aller Maßnahmen, die zur Erkennung einer Krankheit führen) umfasst die Anamnese, die körperliche Untersuchung mit und ohne Geräte sowie die Laboranalyse.
Die Anamnese ist eine systematische Befragung mit Bezug auf
die Schmerzcharakteristika der aktuellen Beschwerden: Wo ist der Schmerz lokalisiert? Strahlt er aus? Seit wann besteht der Schmerz? Wie stark ist der Schmerz? Gibt es Begleitsymptome?
die gesundheitliche Vorgeschichte: früheres Auftreten der gleichen Beschwerden; Vorerkrankungen wie Tumor, Trauma; besondere Dispositionen wie Allergien, Erbkrankheiten, regelmäßige Medikation; etc.
Lebensumstände: berufliche physische oder psychische Belastung; private physische oder psychische Belastung; Sport; Ernährung; etc.
Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Überprüfung möglicher Warnhinweise auf eine spezifische Ursache („red flags“) gelegt, da in diesen Fällen oft dringender Handlungsbedarf besteht. Außerdem werden auch mögliche Risikofaktoren für eine Chronifizierung der Rückenschmerzen („yellow flags“) überprüft.
FAKT 4: KÖRPERLICHE UNTERSUCHUNG ALS WICHTIGER BESTANDTEIL
Die körperliche Untersuchung bei Kreuzschmerz soll helfen, spezifische Ursachen zu erkennen und abwendbar gefährliche Erkrankungen auszuschließen.
Das Ausmaß der körperlichen Untersuchung richtet sich nach den Ergebnissen der Anamnese und wird meist nicht mehr vom Allgemeinmediziner vorgenommen. Mögliche Untersuchungen sind:
Bewegungsprüfung wie (1) Fersenstand, (2) Zehenstand, (3) Finger zu Boden Abstand, (4) Lasegue-Test, (5) Gangbild
Palpation
Inspektion beispielsweise auf Deformation, Hüftfehlstellung
Muskeleigenreflextest
Bildgebende Verfahren wie MRT, Ultraschall, Röntgen.
Auch die Laboruntersuchungen richten sich nach den Ergebnissen der Anamnese und auch dem der körperlichen Untersuchung und werden nur bei einem Verdacht auf eine Entzündung oder tumoröse Veränderungen durchgeführt. Zu diesen Untersuchungen gehören u.a.:
Blutbild
Biopsien.
Weiterte Untersuchungen bei chronischen Rückenschmerzen, die in der fachspezifischen Betreuung insbesondere durch den Schmerztherapeuten sinnvoll sein können, sind:
Bestimmung des Schweregrads der Beschwerden (Graduierung der Schmerzen)
Bestimmung des Chronifizierungsstadiums
validierte Schmerzfragebögen wie der deutsche Schmerzfragebogen.
FAKT 5: THERAPIEZIELE SIND ABHÄNGIG VOM TYP DER RÜCKENSCHMERZEN
Die Therapie der Rückenschmerzen hat je nach Typ der Rückenschmerzen (akut/ subakut vs. chronisch) verschiedene Ziele.
Akute/ Subakute Rückenschmerzen:
Adäquate Kontrolle der Symptome, d.h. Linderung der Schmerzen, so dass die Betroffenen ihren täglichen Aktivitäten schnellstmöglich wieder nachgehen können;
Prävention einer Chronifizierung (bei „yellow flags“: Förderung eines adäquaten (bio-psycho-sozialen) Krankheitsverständnisses);
Vermeidung von diagnostischen Maßnahmen ohne Konsequenzen und
Vermeidung des Risikos einer iatrogenen Fixierung.
Chronische Rückenschmerzen:
Stabilisierung eines adäquaten (bio-psycho-sozialen) Krankheitsverständnisses;
Verständigung auf ein gemeinsames Krankheitsmodell und Förderung der aktiven Mitarbeit der Patientinnen/ Patienten;
Verhinderung von schädigendem Krankheitsverhalten;
Einleitung einer zeitnahen effizienten somatischen Therapiestrategie und umfassende Aufklärung durch die behandelnden Ärztinnen/ Ärzte, sofern notwendig auch Einsatz psychotherapeutischer Intervention;
Erhaltung bzw. Wiederherstellung der Arbeits- und Erwerbsfähigkeit;
Beratung über die sozialmedizinischen Auswirkungen der Erkrankung unter Berücksichtigung der Arbeitssituation;
Vermeidung bzw. Verminderung von Behinderung oder Pflegebedürftigkeit;
Wiederherstellung der normalen Bewegungsabläufe des Körpers;
Kräftigung der Rückenmuskulatur, um den Halteapparat des Rückens zu entlasten.
FAKT 6: THERAPIEABLAUF RICHTET SICH NACH NATIONALEN VERSORGUNGSLEITLINIEN
Die Therapie bei Rückenschmerzen richtet sich wie schon die Diagnostik nach den Vorgaben der nationalen Versorgungsleitlinien. Dabei wird zum einen in die Versorgung der unterschiedlichen Rückenschmerzstadien akut, subakut und chronisch unterschieden und zum anderen darin, welche Behandlung durchgeführt werden soll/ sollte und welche durchgeführt werden kann, wenn der Arzt dies für angeraten erachtet.
Versorgung akuter Rückenschmerzen:
Medikation zur Schmerzlinderung (Paracetamol, NSAR);
ärztliche Aufklärung als präventive Beratung zur Vermeidung einer Schonhaltung oder verminderter Bewegung;
Aktivierung der Betroffenen;
Progressive Muskelrelaxation;
Manipulation/Mobilisation;
Wärme.
Versorgung subakuter Rückenschmerzen:
Schulungsmaßnahmen, inkl. Rückencoaching;
Verhaltenstherapie, inkl. Rückencoaching;
Schmerzmittel (NSAR, Opioide; Muskelrelaxantien);
Aktivierung der Betroffenen;
Progressive Muskelrelaxation;
Manipulation/ Mobilisation;
Massage;
Rückenschule;
Wärme.
Versorgung chronischer Rückenschmerzen:
Schulungsmaßnahmen, inkl. Rückencoaching;
Verhaltenstherapie, inkl. Rückencoaching;
Schmerzmittel (NSAR, Opioide, Muskelrelaxantien);
Animation zur Bewegung;
Bewegungstherapie;
Progressive Muskelrelaxation;
Ergotherapie;
Rückenschule;
Manipulation/ Mobilisation;
Massage;
Akupunktur.
FAKT 7: NICHT JEDER ARZT HAT DIE GLEICHE SPEZIALISIERUNG
Nicht jeder Arzt ist auf jede der genannten Versorgungen (siehe Fakt 6) spezialisiert.
Da die Erstkonsultation meist im hausärztlichen Bereich bei einem Allgemeinmediziner stattfindet, erfolgt dort überwiegend die Versorgung der akuten Rückenschmerzen mit Medikamenten, der Aufklärung und der Animation zur Bewegung.
Liegt eine spezifische Ursache der Rückenschmerzen vor oder sind die unspezifischen Rückenschmerzen durch Medikation und Bewegung nicht therapierbar, wird der Patient meist an den entsprechenden Spezialisten überwiesen. Dort erfolgt dann die Versorgung der subakuten und chronischen Rückenschmerzen. Auch hier gibt es Spezialisten für jeden Bereich.
Bei einem Orthopäden stehen Schmerzmittel, Chirotherapie, manuelle Therapie und Akupunktur im Vordergrund.
Das Ziel der Physiotherapeuten ist die Wiederherstellung der normalen Bewegungsabläufe mit Hilfe von Krankengymnastik, therapeutische Massagen, Lymphdrainage, Wärmeanwendungen (z.B.: Fango) und manuelle Therapie. Medikamente verschreiben sie keine.
FAKT 8: THERAPEUTISCHER EIGENANTEIL DES PATIENTEN
Bei allen Therapiemodellen ist jedoch die aktive Beteiligung des Betroffenen während der Therapiesitzung und darüber hinaus auch zu Hause wichtig. Vermehrte leichte Bewegung, Entspannungsübungen, Stressabbau, gegebenenfalls Gewichtsreduktion und ausreichend erholsamer Schlaf tragen zur Schmerzreduktion bei und unterstützen so das jeweilige Therapiekonzept. Motivation und Selbstinitiative sind entscheidend – ggfs. müssen diese durch einen externen Rückencoach gestärkt und gefördert werden. Krankenkassen übernehmen zum Teil die Kosten.