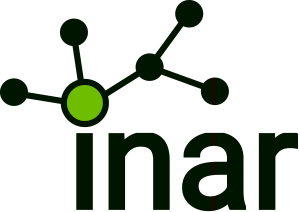Rückenschmerzen sind nach Kopfschmerzen die zweithäufigsten Beschwerden, mit denen Patienten einen Arzt aufsuchen. Aus diesen Gründen entstehen erhebliche Kosten für Krankenkassen und Wirtschaft. Insgesamt ergaben Berechnungen, dass nur durch Rückenschmerzen in Deutschland pro Jahr Kosten in Höhe von 48,9 Milliarden Euro verursacht werden, also 1,4 Prozent des Deutschen Bruttoinlandproduktes. Rückenschmerzen sind so kostenintensiv, da nicht nur viele Menschen davon betroffen sind, sondern weil sie häufig Ursache von Krankmeldungen und Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen sind. Hoch sind deshalb insbesondere die mit Rückenschmerzen verbundenen indirekten Kosten, die als Lohnfortzahlung und Krankengeld Arbeitgeber und Krankenkassen belasten. Bei Männern sind Rückenschmerzen mit 14% die häufigste Ursache für Arbeitsausfälle, bei Frauen mit 11% die zweithäufigste.
Oft ist der Patient auch persönlich von den Kosten betroffen, da er bei Heil- und Hilfsmitteln, speziellen Anwendungen und anderen Leistungen hinzuzahlen muss oder Einkommensverluste aufgrund von Arbeitsunfähigkeit hat.Das Helmholtz-Zentrum München und die Universität Greifswald haben im Rahmen einer Befragung von mehr als 9200 Deutschen ermittelt, wie sich etwa Geschlecht, Alter, Bildung und Familienstand auf die durch Rückenschmerzen verursachten Kosten auswirken. Diese Kosten steigen je länger die Krankheit anhält bzw. die Chronifizierung voranschreitet. Direkte Kosten, also Ausgaben, die durch die Behandlung der Beschwerden entstanden, nahmen 46 Prozent ein und entsprachen damit in etwa den indirekten Kosten, also Produktionsausfällen, mit 54 Prozent. Die höchsten Kosten entstanden im Alter von 50 Jahren. Unter den Patienten, die Leistungen in Anspruch nahmen, wirken auch soziale Umstände wie Arbeitslosigkeit, niedrige Bildung und Singledasein Kosten steigernd. Ein Rückenschmerzpatient verursacht jährlich durchschnittlich 1322 Euro an Kosten. Wobei Patienten mit spezifischen Rückenschmerzen höhere Kosten verursachen als Patienten mit Schmerzen bei Bandscheibenerkrankungen oder Patienten mit unspezifischen Rückenschmerzen. Fakt 3 detailliert die Kosten je nach Kostenart. Studien der DAK Unternehmen Leben hat die einzelnen Kosten von Rückenschmerzpatienten untersucht. Zwar stammen diese Werte noch aus den vergangenen Jahren, jedoch zeigen neuere Analysen, dass sich die prozentualen Verteilungen nicht unwesentlich verschoben haben. Der größte Ausgabenanteil bei Rückenschmerzen entfällt auf die ambulanten ärztlichen Leistungen – sowohl für Patienten mit spezifischen Rückenschmerzen als auch Patienten mit Bandscheibenerkrankungen oder Patienten mit unspezifischen Rückenschmerzen. In den ambulanten Kosten auch enthalten sind die Ausgaben für bildgebende Verfahren wie Röntgen und MRT. An zweiter Stelle liegen bei Patienten mit spezifischen Rückenschmerzen Kosten für Heil- und Hilfsmittel – meist muss der Patient hier auch zuzahlen. Hingegen sind bei Patienten mit Bandscheibenerkrankungen bereits die Ausgaben für Krankengeldzahlungen an Position 2. Diese machen in dieser Gruppe einen Anteil von nahezu einem Viertel der Gesamtkosten aus. Die Ausgaben für Schmerzmittel (Tabletten etc.) liegen bei spezifischen Rückenschmerzen etwa gleichauf mit den Krankenhausausgaben. Die Krankenhaustage bei Patienten mit spezifischen Rückenschmerzen betragen mehrheitlich zwischen 5 bis 6 Tage, wohingegen Patienten mit Bandscheibenerkrankungen knapp 3 Tage und Patienten mit unspezifischen Rückenschmerzen durchschnittlich 1,5 Tage im Jahr im Krankenhaus verweilen. Untersuchungen zeigen, dass die Inanspruchnahme sowohl im ambulanten ärztlichen Bereich, beim Einsatz von Analgetika, bei den Heil- und Hilfsmitteln, als auch bei der Rehabilitation bei Patienten mit spezifischen Rückenschmerzen am höchsten ist. Patienten mit Bandscheibenerkrankungen haben die höchsten Kosten bei der bildgebenden Diagnostik und den Kosten verursacht durch Arbeitsunfähigkeitstage. Bandscheibenerkrankungen sind somit der häufigste Rückenschmerzbezogene Grund für Arbeitsunfähigkeit. Abbildung 2 zeigt eine Gegenüberstellung der medizinischen Leistungsinanspruchnahme bei Patienten mit Rückenschmerzen. Laut einer Studie der Bertelsmann Stiftung gehen der deutschen Wirtschaft bis zu 75 Milliarden Euro verloren, da sich Patienten nicht an die empfohlene Therapie ihres/ seines Arztes halten. Im Vergleich dazu liegen andere Länder wie z.B. England mit 28-50 Milliarden Euro weit darunter. Innerhalb der Studie wurden die volkswirtschaftlichen Kosten durch fehlende Therapietreue am Beispiel der fünf Krankheiten Depressionen, chronischen Rückenschmerzen, Asthma, Bluthochdruck und Gelenkrheuma untersucht. Am höchsten werden die Folgekosten durch Produktivitätsverluste bei chronischen Rückenschmerzen eingeschätzt (neun bis 26 Milliarden Euro), gefolgt von Patienten mit Depressionen. Die Wissenschaftler argumentieren, dass durch eine bessere Therapiebegleitung der Patienten das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um bis zu 20 Milliarden Euro erhöht werden könnte. Denn die Kosten des Produktivitätsverlustes sind bei Patienten mit chronischen Rückenschmerzen und Depressionen viel höher als die medizinischen Behandlungskosten. Ursache hierfür sind die häufig bedingten Arbeitsausfälle und damit Senkung der Produktivität. Bei den anderen untersuchten Erkrankungen (Gelenkrheuma, Asthma und Bluthochdruck) überwiegen dagegen die Behandlungskosten im Vergleich zu den volkswirtschaftlichen Folgekosten. Es zeigt sich, dass Rückenschmerzen verhältnismäßig wenig an direkten medizinischen Kosten verursachen, dafür aber hohe Kosten aufgrund von Arbeitsausfall. Bei einer verbesserten Einhaltung des Therapieplanes zur Bekämpfung v.a. chronischer Rückenschmerzen, profitieren Unternehmen und Sozialkassen. Dagegen ergibt die Bertelsmann Studie, dass v.a. das medizinische Personal (Ärzte, Pflegemitarbeiter etc.) keine bzw. kaum finanzielle Vorteile hätte. Kurzfristig würden für die Krankenkassen höhere Kosten entstehen. Erst mittel- bis langfristig würden aufgrund geringerer Krankengeldzahlungen Einsparungen entstehen.
Die Studie der Bertelsmann Stiftung schlägt vier Möglichkeiten vor, um die Patientenbegleitung mit dem Ziel größerer Therapietreue voranzubringen:
Wirtschaftliche Anreize für Ärzte, Pflegemitarbeiter und Patienten: Als Beispiel nennen die Autoren eine Gebührenordnungsziffer, die Ärzte unmittelbar für den Zeiteinsatz bei der Beratung von Patienten honoriert.
Aktive Beteiligung von Arbeitgebern, Kassen und anderen Kostenträgern. Eine genaue Beschreibung wird jedoch in der Studie nicht erwähnt.
Neue „Geschäfts- und Servicemodelle im Gesundheitswesen“ sollten etabliert werden, auf die Ärzte zurückgreifen können. Care-Management und Patientencoaching, wie ein personalisiertes Rückencoaching, sollten dazu dienen, Patienten zu motivieren, Eigeninitiative zu stärken und bei der Therapie-Einhaltung individuell zu unterstützen.
Die Versorgungsforschung sollte neu ausgerichtet werden, um Effekte der Therapietreue besser als bisher zu messen. Trotz vieler Studien sei die Datenlage hierzu unzureichend.
Fehlende Motivation ist ein wesentlicher Kostentreiber, da dies einer der Hauptgründe für einen Therapieabbruch oder nicht genaue Durchführung einer empfohlenen Therapie ist. Patienten verlieren das Interesse und den Selbstantrieb, weil sich der Nutzen der Therapietreue teilweise erst langfristig zeigt. So steht in einer Ausgabe der Ärztezeitung (2012) geschrieben: „unter den aktuellen Rahmenbedingungen fällt es einem Patienten leicht, Dinge mit der Begründung “Ich fange morgen an, die Übungen zu machen“ aufzuschieben.“ Weiter steht, dass Medikamentennebenwirkungen und die Verpflichtung zu einer regelmäßigen Behandlung die Entschlossenheit eines Patienten beeinflussen können, sich an einen Therapieplan zu halten, stark einschränken. Rückencoachings, e-Health Anwendungen oder auch flexible Arbeitseinteilung können Menschen unter solchen Umständen unterstützen, einen für Sie personalisierten Therapietreue-Ansatz in Ihr Alltagsleben zu integrieren und so sowohl die eigenen Kosten als auch die volkswirtschaftlichen Gemeinkosten zu senken. Krankenkassen müssen Medikamente, ärztliche Behandlung beim niedergelassenen Arzt und im Krankenhaus und sogenannte Heilmittel zahlen. Auf welche Leistung man Anspruch hat, hängt von der „Notwendigkeit“ (notwendig, ausreichend oder zweckmäßig) ab. Die Maßnahmen müssen wirtschaftlich erfolgen, die Krankenkassen dürfen also nicht unnötig teure Leistung übernehmen.
Auf die folgenden Behandlungen haben alle gesetzlich Versicherten bei Rückenschmerzen einen Anspruch:
Arzneimittel und Operationen
Heilmittel wie Krankengymnastik, Chirotherapie, medizinische Bäder, Wärme- und Elektrotherapie oder Massagen. Diese Heilmittel dienen dazu, Rückenschmerzen zu lindern und Verschlechterungen zu verhüten. Sie müssen immer von einem Arzt verordnet werden. Ebenso werden sie immer von einem von den Kassen anerkannten Physiotherapeut durchgeführt. Die Kassen zahlen nur solche Heilmittel, deren therapeutischer Nutzen erwiesen ist. Volljährige Patienten müssen ähnlich wie bei den Arzneimitteln einen gewissen Teil der Kosten übernehmen. Die Zuzahlung beträgt 10% der Kosten des Heilmittels, hinzu kommen 10 Euro je Verordnung. Diese kann mehrere Anwendungen umfassen und gilt für 14 Tage.
Was Kassen inzwischen bezahlen
Seit 2007 wird Akupunktur bezahlt, wenn der Arzt sie zur Linderung von chronischen Schmerzen der Lendenwirbelsäule verordnet. Die Schmerzen müssen schon seit mindestens einem halben Jahr andauern und der Arzt benötigt eine Zusatzausbildung zum Akupunkteur.
Krankenkassen übernehmen die Kosten für 10 Sitzungen. Zusätzlich weitere 5 Termine können Patienten in Ausnahmefällen beanspruchen.
Erst nach wieder frühestens 12 Monaten ist eine erneute Behandlung möglich.
Ebenfalls zählt Homöopathie mittlerweile zu den Kassenleistungen. Versicherte können sich von einem Mediziner mit einer solchen Zusatzausbildung beraten lassen.
Dazu gehören eine homöopathische Erst- beziehungsweise Folgeanamnese, sowie die Auswahl der homöopathischen Mittel.
Die Arzneien muss der Patient in der Regel selbst zahlen.
Laut Paragraph 20 SGB V (Sozialgesetzbuch) sind alle gesetzlichen Krankenkassen verpflichtet, präventive Gesundheitssportkurse zu bezuschussen. Voraussetzungen sind eine erfolgreiche Prüfung der Kursinhalte sowie der Qualifikation des Kursanbieters durch die Spitzenverbände der Krankenkassen.
Die Krankenkassen zahlen zwischen 80 % und 100 % der Kursgebühren (mind. 75 €).
In jedem Kalenderjahr können 1- 2 Kurse aus verschiedenen Bereichen bezuschusst werden. Den gleichen Kurs kann man erst wieder nach zwei Jahren wiederholen.
Demgegenüber zahlt keine Krankenkasse ihren Rückenschmerzpatienten die Behandlung bei Heilpraktikern, es sei denn, man hat eine private Zusatzversicherung abgeschlossen, die eine Übernahme der Kosten ermöglicht. Insgesamt gaben die Krankenkassen in den letzten Jahren zwischen 175 und 190 Milliarden Euro für Gesundheitsleistungen aus. Dabei mussten in den letzten Jahren die gesetzlichen Krankenkassen immer höhere Kosten für die sogenannte Heil-und Hilfsmittel ausgeben. Spitzenreiter für Krankengymnastik sind chronische Rückenschmerzpatienten. Wie aus einem Barmer GEK Bericht zu Heil- und Hilfsmitteln hervorgeht, wurden im Jahr 2009 zehn Milliarden Euro für Krankengymnastik, Logo- und/ oder Ergotherapien sowie technischen Hilfen wie Hörgeräte und Rollstühle ausgegeben. Aus diesem Grund wird in den letzten Jahren immer häufiger versucht die Zuzahlungen zu Heil- und Hilfsmitteln zu reduzieren. Neue Therapieverfahren, wie z.B. auf dem Gebiet der Elektrostimulation, werden nicht mehr in den Katalog aufgenommen. Ob dies mittel- bis langfristig vorteilhaft ist darf bezweifelt werden.
www.Bomedus.com